FAQ – Corona und Kirche
Fragen und Antworten zu Gottesdiensten, Chorproben, Internetübertragungen, Gemeindeleben und mehr
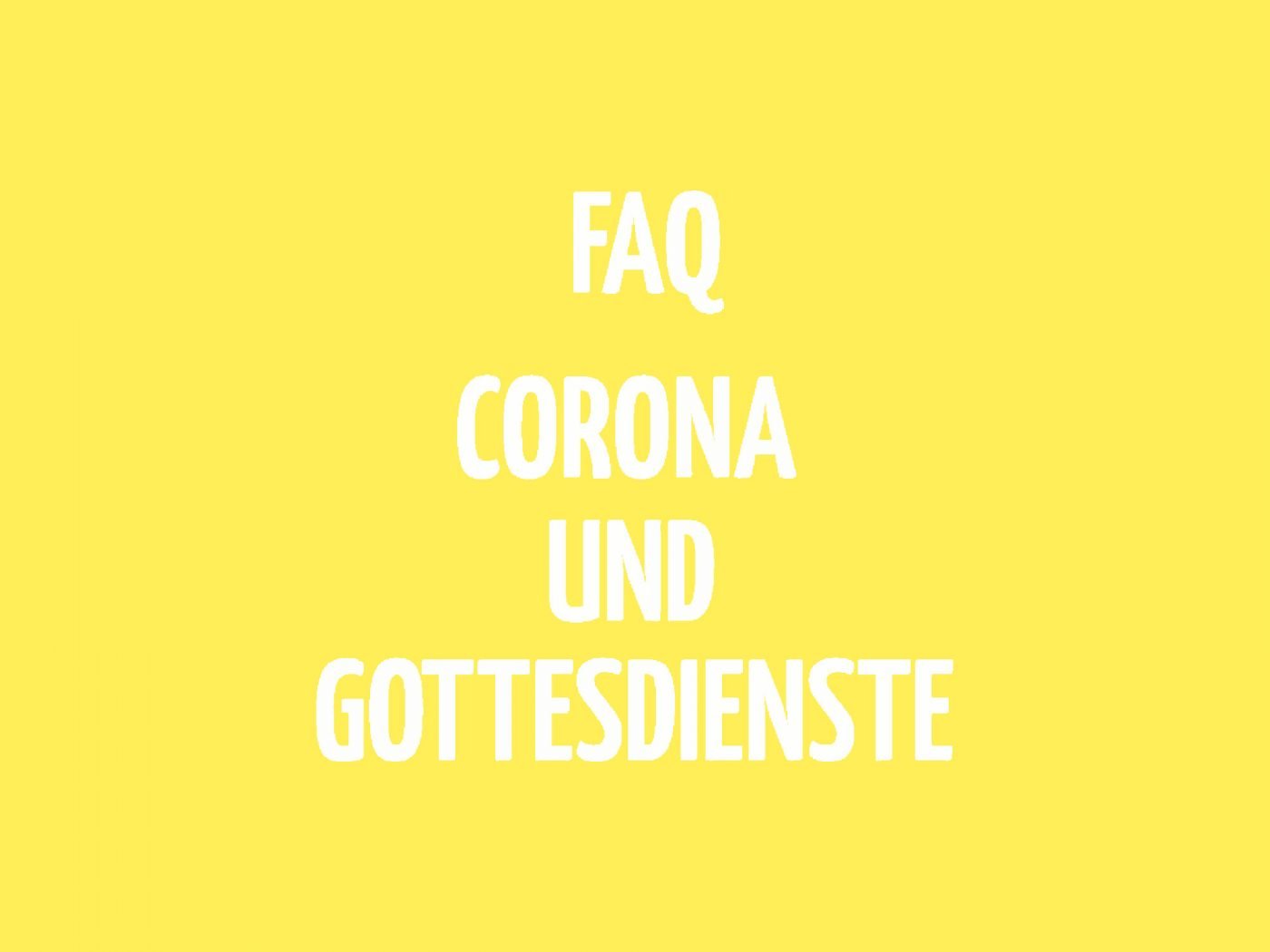
Fragen und Antworten zu Gottesdiensten, Chorproben, Internetübertragungen, Gemeindeleben und mehr
In Folge der andauernden Corona-Situation haben sich die Bestimmungen zur Durchführung von Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen im Laufe der letzen Monate mehrfach geändert. Hier finden Sie Antworten zu häufigen Fragen, die das Kirchenamt dazu erreicht haben. Ausführliche Informationen dazu enthalten auch die „ Empfehlungen für Gottesdienste ab dem 15. Mai 2020 der Kommission für Gottesdienst und Kirchenmusik“, die am 30. April allen Pfarrgemeinden übermittelt wurden. Darüber hinaus finden Sie im Folgenden auch Informationen etwa zur Abhaltung von Sitzungen, Kreisen, Konfirmandenunterricht und Veranstaltungen, sowie zu urheberrechtlichen Fragen beim Streamen von Gottesdiensten via Internet und zur Gestaltung des Bürobetriebes. Da uns eine Aktualisierung der Angaben unmittelbar nach Bekanntgabe neuer Bestimmungen leider nicht immer zeitnahe möglich ist, beachten Sie bitte unbedingt das Beitragsdatum hinsichtlich der Aktualität/Gültigkeit.
„COVID-19: So schützen wir uns“ – Plakat zum Download
Letzte Aktualisierung der FAQs: 19.12.2022
Die neuesten Änderungen können Sie am vorangestellten Stern-Symbol (☆) erkennen.
Alle aufklappen Alle zuklappen
Öffentliche Gottesdienste:
Unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen können öffentliche Gottesdienste gefeiert werden.
Ob tatsächlich öffentliche Präsenzgottesdienste abgehalten werden, entscheidet das Presbyterium. Die Presbyterien werden um eine sorgfältige Erwägung der lokalen Gegebenheiten wie Infektionszahlen, Auftreten von Virusmutationen aber auch der räumlichen Möglichkeiten und von Alternativangeboten ersucht. Es soll sich jedenfalls niemand unter Druck gesetzt fühlen, einen Gottesdienst abzuhalten.
Jedenfalls möglich sind online Formate. Diese sind und waren nicht mit dem Begriff „öffentliche Gottesdienste“ gemeint.
Die Presbyterien entscheiden ob öffentliche Gottesdienste abgehalten werden und wenn ja in welcher Form. Sie können Präsenzgottesdienste weiterhin aussetzen. Niemand soll sich unter Druck gesetzt fühlen, einen Gottesdienst abzuhalten, insbesondere wenn die lokalen Entwicklungen und räumlichen Gegebenheiten nicht dafür sprechen.
Es sind derzeit keine rechtlich verbindlichen Maßnahmen verordnet. Mitwirkende müssen keinen G-Nachweis mehr erbringen. Die Pfarrgemeinden sind aber für den Schutz der Gottesdienstbesucher und Gottesdienstbesucherinnen verantwortlich und müssen die den Umständen vor Ort angemessenen Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Die Kirchenleitung empfiehlt weiterhin dringend:
- Mindestabstand von einem Meter zu haushaltsfremden Personen, besser zwei Meter, wenn möglich
- Beibehaltung der FFP2 Maske
- Sorgsamer Umgang mit Gemeindegesang, jedenfalls nur mit FFP2-Maske
- Chorgesang ist möglich, sollte aber besonders verantwortungsvoll gehandhabt werden. Ersatzweise ist der Einsatz von Solistinnen/Solisten und kleineren Besetzungen zu prüfen.
Darüber hinaus sind alle Presbyterien dringend aufgerufen, über diesen Mindeststandard hinaus weitere Maßnahmen vorzusehen, wobei die Größe der Gottesdiensträume, die Möglichkeit digitaler Formate, die lokale Corona-Situation und sonstige Umstände vor Ort berücksichtigt werden sollen. In Frage kommen insbesondere bekannte Maßnahmen wie bestmögliche Durchlüftung oder ein Willkommensdienst.
Nein. Gottesdienste sind von der Verordnung des Gesundheitsministers gänzlich ausgenommen. Nach den bundesweit geltenden Vorschriften dürfen auch Personen, die keinen Nachweis erbringen können, einen Gottesdienst besuchen. Es liegt an den Presbyterien aufgrund dieser Ausnahme für ihre Gemeinden die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen freiwillig vorzusehen.
Es gibt derzeit keine zwingend einzuhaltenden Maßnahmen. Die Pfarrgemeinden sind aber für den Schutz der Mitwirkenden und der Gottesdienstbesucher und Gottesdienstbesucherinnen verantwortlich und müssen die den Umständen vor Ort angemessenen Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Es wird insbesondere ein sorgsamer Umgang mit Gemeinde- und Chorgesang empfohlen. Bei Gemeindegesang sollten FFP2-Masken getragen werden. Chorgesang ist möglich, sollte aber besonders verantwortungsvoll gehandhabt werden. Ersatzweise ist der Einsatz von Solistinnen/Solisten und kleineren Besetzungen zu prüfen. Wo möglich sollte vorher ein CoViD-Test gemacht werden.
Die katholische Kirchenmusikkommission bietet auf ihrer Homepage (www.kirchenmusikkommission.at) weiterführende Informationen an, die auch für den evangelischen Bereich als Orientierung und Empfehlung dienen können.
Aufgrund der aktuellen Verordnung des Gesundheitsministers ist für das stille Gebet und zur individuellen Religionsausübung keine Maske mehr zu tragen. Darüber hinaus können für einzelne Bundesländer zusätzliche Maßnahmen verordnet werden. Eine Übersicht über die regionalen Maßnahmen finden Sie auf corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/ oder auf der Homepage der Landesregierung. Die rechtsverbindlichen Verordnungen können über das RIS (www.ris.bka.gv.at/Land/) abgerufen werden. Es steht den Gemeinden frei, weiterhin eine Maskenpflicht oder andere Schutzmaßnahmen vorzusehen.
Feiergottesdienste (Taufen, Konfirmationen und Hochzeiten) sind unter Einhaltung der allgemeinen Regeln für Gottesdienste möglich. Die freiwillige Erstellung eines Präventionskonzeptes, wie es bei sonstigen Veranstaltungen vorgeschrieben ist, wird dringend empfohlen.
Für alle Aktivitäten außerhalb des eigentlichen Gottesdienstes gelten die staatlichen Bestimmungen für Zusammenkünfte. Bitte beachten Sie, das regionale Verschärfungen möglich sind. Sie können sich unter www.sichere-gastfreundschaft.at über die aktuellen Vorgaben informieren.
Begräbnisse dürfen auch ohne 3G-Nachweis besucht werden. Für den Begräbnisgottesdienst, Totenwache und kirchliche Verabschiedungsfeiern gelten die Vorgaben für Gottesdienste. Darüber hinaus kann es am Friedhof und in Aufbahrungshallen zusätzliche Vorgaben durch staatliche Bestimmungen geben, auch regionale und örtliche Unterschiede sind möglich.
Die 2G und 2,5G-Regelung ist derzeit aufgrund der epidemiologischen Lage und den Lockerungen der staatlichen Maßnahmen ausgesetzt.
Sollte sich die Situation wieder verschlechtern, kann die entsprechende gesetzliche Verpflichtung aber wieder in Kraft gesetzt werden. Wenn es die Lage in einzelnen Pfarrgemeinden oder Regionen erfordert, kann der zuständige Superintendentialausschuss A.B. bzw. der Oberkirchenrat H.B. befristet eine 2G, bzw. 2,5G-Regelung mit Bescheid in Kraft setzen. Diese können nach Maßgabe der Verfahrensordnung von den betroffenen Presbyterien bekämpft werden.
Hierbei gibt es grundsätzlich keine FFP2 Maskenpflicht. Im Pfarrbüro sind aber bei „Kundenkontakt“ weiterhin FFP2-Masken zu tragen. Wenn es sich um ein seelsorgerliches Gespräch oder Religionsausübung handelt, müssen Besucher und Besucherinnen keinen Nachweis erbringen, es steht aber den Gemeinden frei strengere Regeln vorzusehen.
Seelsorger und Seelsorgerinnen müssen über keinen G-Nachweis verfügen, wenn sie ein Seelsorgegespräch führen. Es gelten dieselben Ausnahmen und Übergangsbestimmungen wie für Gottesdienste, sie können weiter oben nachgelesen werden.
Wünschen Gemeindemitglieder ein Gespräch bei sich zuhause, verlangt das staatliche Recht nicht, dass Masken getragen werden. Allen Seelsorgern und Seelsorgerinnen wird es auf freiwilliger Basis dringend empfohlen.
Alle aufklappen Alle zuklappen
Gottesdienste im Internet:
Sie finden viele Lieder unter www.liederdatenbank.de/songbook/8984. Beachten Sie, dass nicht alle Lieder hier veröffentlicht sind, da urheberrechtlich geschützte Lieder nicht angezeigt werden. Gegebenenfalls sollten Sie die Verfügbarkeit vor Ihrem Gottesdienst prüfen. Die Nummerierung stimmt mit dem Evangelischen Gesangsbuch in der Ausgabe der Evangelischen Kirche in Österreich aus dem Jahr 2000 überein.
Selbstverständlich dürfen Sie Ihre Gottesdienste und Feiern wie in den vergangenen Wochen auch virtuell abhalten! Sie müssen jedoch weiterhin das Urheberrecht beachten.
Die Rechte des Schöpfers oder Urhebers am eigenen Werk (eigene Leistung!) entstehen mit der Schaffung des Werks. Dies gilt für geistige Leistungen aller Art, wie eben auch Literatur, Musik, Musiktexte, Fotos, Filme, etc. Das Urheberrecht gilt bis 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers oder Urhebers.
Urheberrechtlich unbedenklich sind grundsätzlich freie Werke, d.h. Werke die älter als 70 Jahre nach dem Tod der/des Komponist*in/in/Autor*in (Urheber*in) sind. Diese Lieder dürfen Sie jedenfalls singen und die Texte zum Download bereitstellen.
Urheberrechtlich geschütztes Liedgut dürfen Sie in derselben Art verwenden, wie im Gottesdienst. Sie dürfen auch geschütztes Material singen und die Texte einblenden, als würden Sie einen Beamer / PowerPoint verwenden.
Achtung: Möchten Sie den Mitschnitt mit eingeblendetem Text auf YouTube veröffentlichen, sollten Sie die Texte ausblenden.
Ja, das dürfen Sie, jedoch nur für 72 Stunden.
Sie dürfen selbstverständlich nur Videos von jenen Personen ins Internet stellen, die zugestimmt haben. D.h. Mitschnitte von Veranstaltungen mit Mitgliedern, die eigentlich nur für die Archivierung angefertigt wurden, sollten Sie nicht ohne die Zustimmung der Aufgenommenen veröffentlichen.
Ja. Auch aufgehängte Kunstwerke (Fotografien, Glasfenster, Skulpturen) könnten urheberrechtlich geschützt sein. Daher könnte eine Aufnahme und die Veröffentlichung im Internet möglicherweise einen Verstoß gegen das Urheberrecht darstellen. Bemühen Sie sich gegebenenfalls um die Zustimmung der Künstlerin oder des Künstlers.
Ja. Der EUGH hat sich 2014 mit diesem Thema beschäftigt und entschieden, dass die Einbettung von Videos grundsätzlich zulässig ist und keine Urheberrechtsverletzung darstellt, so lange man auf die Plattform YouTube geleitet wird (also keine neue Technologien einsetzt). Dies gilt natürlich nur für legale Aufnahmen. Es geht bei YouTube darum: Wer erhält die „Likes“ für das Video – Sie für den Gottesdienst, aber der Künstler oder die Künstlerin möchten die „Likes“ für IHR eigenes Video.
Nach besagtem EuGH Urteil (s.o.) ist auch hier die Rechtslage relativ klar: Man darf Videos privat vorführen, aber nicht selbst weiterveröffentlichen.
Sie können Folgendes tun:
- 1. Die Einwilligung der Ersteller der YouTube-Videos einholen. Gibt es vielleicht Lieder, die von bekannten evangelischen anderen Pfarrgemeinden gesungen wurden? Dort könnte man sicher rasch eine Einwilligung holen!
- 2. Die Videos könnten dann eingebettet auf Ihrer Webseite zur Verfügung gestellt werden und auf YouTube verlinken. Es geht natürlich wieder um die „Likes“.
- 3. Sie können einen Gottesdienst aufzeichnen und vor dem Hochladen die YouTube-Videos von anderen ausblenden.
Bitte beachten Sie, dass dieses Lied urheberrechtlich geschützt ist und man vor Aufnahme eines Videos samt Veröffentlichung auf YouTube Lizenzen an die Warner Music Group (WMG) sowie Sony entrichten muss. Bitte wenden Sie sich für den Erhalt einer Lizenz an QFO@rinat.ng.
Alle aufklappen Alle zuklappen
Gemeindeleben:
Die bundesweit geltenden Mindestvorgaben lauten wie folgt:
- Bei Zusammenkünften gibt es keine G-Regelung und es besteht keine Maskenpflicht. Nächtigungen, das Verabreichen von Speisen und der Ausschank von Getränken sind zulässig.
- Bei Zusammenkünften mit mehr als 500 Teilnehmern ist eine COVID-19-Beauftragte bzw. ein COVID-19-Beauftragter zu bestellen sowie ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten.
Zusätzlich zu der Verordnung des Gesundheitsministers besteht für die einzelnen Bundesländer die Möglichkeit, strengere Bestimmungen zu erlassen. Informieren Sie sich daher über die in Ihrem Bundesland konkret geltenden Bestimmungen für „Zusammenkünfte“. Eine Übersicht über die regionalen Maßnahmen finden Sie auf corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/ oder auf der Homepage der Landesregierung. Die rechtsverbindlichen Verordnungen können über das RIS (www.ris.bka.gv.at/Land/) abgerufen werden.
Für Proben gelten nach der Verordnung des Gesundheitsministers sinngemäß die Bestimmungen für „Zusammenkünfte“.
Bei Proben im Rahmen des Kirchenchores oder der Bläsergruppe gibt es keine G-Reglung und es besteht keine Maskenpflicht.
Bei diesen Zusammenkünften mit mehr als 500 Teilnehmern ist aber eine COVID-19-Beauftragte bzw. ein COVID-19-Beauftragter zu bestellen sowie ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten.
Über die bundesweit geltenden Maßnahmen hinaus bestehen jedoch in einzelnen Bundesländern zusätzliche Auflagen. Beachten Sie daher die obenstehenden Informationen zu „Zusammenkünften“ und Informieren Sie sich über die in Ihrem Bundesland konkret geltenden Bestimmungen. Eine Übersicht über die regionalen Maßnahmen finden Sie auf corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/ oder auf der Home Page der Landesregierung. Die rechtsverbindlichen Verordnungen können über das RIS (www.ris.bka.gv.at/Land/) abgerufen werden.
Nein, hierfür gibt es keine Rechtsgrundlage.
Das Kirchengesetz betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 im Bereich der Evangelischen Kirchen in Österreich (ABl. Nr. 2/2022) betrifft Gottesdienste, sonstige Veranstaltungen zur Religionsausübung und Seelsorge, nicht aber Sitzungen von kirchlichen Gremien. Für diese Sitzungen gelten ausschließlich die in der nächsten Antwort zusammengefassten staatlichen Bestimmungen über Zusammenkünfte samt den entsprechenden Ausnahmen für Sitzungen von Presbyterium und Gemeindevertretung.
Es gibt derzeit keine Sonderbestimmungen für Sitzungen von kirchlichen Organen. Es gelten daher die allgemeinen Vorschriften für Zusammenkünfte.
Die Möglichkeit Beschlüsse über einen schriftlichen Umlaufbeschluss zu erwirken ist in dringenden Fällen grundsätzlich in der kirchlichen Verfahrensordnung vorgesehen und gilt auch über die Zeit der Corona-Pandemie hinaus.
Beschlussfassungen im Wege einer Videokonferenz wurden für Presbyterien und andere Leitungsgremien grundsätzlich eingeführt. Sie sind über die Zeit der Corona-Pandemie hinaus nach den Bestimmungen der kirchlichen Verfahrensordnung weiter möglich.
Es gibt keine klare Empfehlung, da es viele Betreiber gibt, die datenschutzrechtlich konform sind. Wählen Sie eine Plattform, die möglichst einfach zu bedienen ist.
Beachten Sie, dass Sie eventuell eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung (ADV) mit dem Plattformbetreiber abschließen müssen. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte der Evangelischen Kirche unter QFO@rinat.ng, falls Sie Hilfe benötigen.
Sie benötigen Internet (LAN oder WLAN) und ein internetfähiges Gerät, z.B. Smartphone, PC, Tablet, Laptop. Ein Headset ist empfehlenswert, aber nicht notwendig, da die meisten Geräte über eine eingebaute Kamera und Mikrophon verfügen.
Achten Sie auf eine helle, ruhige Umgebung, dann sieht und hört man Sie am besten!
Nach der Verordnung des Gesundheitsministers (Stand 01.08.2022) gelten folgende Mindestvorgaben:
Bei Zusammenkünften im Rahmen der außerschulischen Jugendarbeit gibt es keine G-Regelung. Es besteht keine Maskenpflicht und Nächtigungen und das Verabreichen von Speisen sowie der Ausschank von Getränken sind zulässig.
Bei Zusammenkünften im Rahmen der außerschulischen Jugendarbeit mit mehr als 500 Teilnehmern ist zusätzlich noch eine COVID-19-Beauftragte bzw. ein COVID-19-Beauftragter zu bestellen sowie ein COVID19-Präventionskonzept auszuarbeiten.
Zusätzlich zu der Verordnung des Gesundheitsministers besteht für die einzelnen Bundesländer die Möglichkeit, strengere Bestimmungen zu erlassen. Informieren Sie sich daher über die in Ihrem Bundesland konkret geltenden, zusätzlichen Bestimmungen. Eine Übersicht über die regionalen Maßnahmen finden Sie auf corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/ oder auf der Home Page der Landesregierung. Die rechtsverbindlichen Verordnungen können über das RIS (www.ris.bka.gv.at/Land/) abgerufen werden.
Kinder- oder Jugend-Gottesdienste gelten nicht als „außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, sondern für sie gelten die Regeln für Gottesdienste.
Allgemeine Hygieneempfehlungen bei außerschulischer Jugendarbeit:
- Altersadäquate Aufklärung der Kinder/Jugendlichen über Hygiene
- Händewaschen: Nach Betreten der Einrichtung und bei Bedarf (z.B. Niesen) und regelmäßig (z.B. vor Einnahme von Mahlzeiten) mind. 30 Sekunden
- Möglichkeit zur Händedesinfektion schaffen und Desinfektionsmittel für Kinder unerreichbar verwahren
- Gesicht (vor allem Mund, Augen, Nase) nicht mit den Fingern berühren. Kein Händeschütteln
- Niesen und Husten in ein Papiertaschentuch oder in die Armbeugen
- Desinfektion in den Räumlichkeiten – insbesondere Gegenstände, Möbel, Türklinken; dabei Wischdesinfektion statt Sprühdesinfektion anwenden
- Regelmäßige Reinigung der verwendeten Materialien und Kontaktflächen
- Regelmäßiges Lüften (zumindest 1x pro Stunde, wenn möglich Querlüften)
- Die Bedürfnisse von Personen, die Risikogruppen zuzurechnen sind, sind zu berücksichtigen, sofern sie (oder ihre Erziehungsberechtigten) dies wünschen.
Ausführlich siehe:
www.bundeskanzleramt.gv.at/service/coronavirus/coronavirus-infos-familien-und-jugend/jugendarbeit.html
Gemeinden, Superintendenturen, Werke und evangelisch-kirchliche Vereine zählen neben vielen anderen zu den begünstigten Organisationen, die beim neu eingerichteten NPO-Unterstützungsfond um eine finanzielle Unterstützung ansuchen können, wenn sie durch Corona einen nachweisbaren Einnahmenausfall haben. Es können bestimmte förderbare Kosten geltend gemacht werden und es wird ein Struktursicherungsbeitrag für pauschale Kosten abgegolten. Es kann beides gleichzeitig, oder jeweils nur eines davon beantragt werden.
Bitte informieren Sie sich vor einer Antragstellung genau auf npo-fonds.at und beachten Sie die dortigen FAQs! Die Antragstellung ist ausschließlich online möglich und bedarf der Bestätigung durch einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater.
Ja, der NPO-Fonds wurde auf das 1. Quartal 2022 verlängert. Anträge für das 1. Quartal 2022 können ab 4. Juli bis 31. Oktober 2022 in digitaler Form auf der Website npo-fonds.at gestellt werden.
Neben den allgemeinen Informationen sind die folgenden kirchenspezifischen Punkte (gilt nicht für Vereine) zu beachten:
Welche (formale) Voraussetzungen müssen für die Antragstellung erfüllt werden?
Anträge und der Fördervertrag (falls extra erforderlich) sind von drei Mitgliedern des Presbyteriums zu unterschrieben und das Amtssiegel ist beizufügen (§ 13 Abs. 2 KVO).
Es braucht zwingend die Bestätigung des Antrags durch eine Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung. Auf dem Antrag muss sich die Unterschrift mit Stempel einer Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung befinden. Es wird dringend davon abgeraten Anträge ohne diese zu stellen. Unvollständige Anträge werden nach hinten gereiht. Es erging seitens der Kirchenleitung die Bitte an die Superintendenturen nach geeigneten Prüfern zu suchen.
Wer trägt die Kosten für die Bestätigung des Antrags durch die Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung?
Die Kosten für die Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung können mit dem Antrag geltend gemacht werden. Wird dieser aber abgelehnt, sind die Kosten selbst zu tragen.
Können ausgefallene Kollekten und Stollgebühren geltend gemacht werden?
Ausgefallene Kollekten und Stollgebühren können als Einnahmenausfall geltend gemacht werden.
Gibt es Einschränkungen bei den förderbaren Kosten?
Wenn es einen nachweisbaren Rückgang beim Kirchenbeitrag gibt, können durch Gemeinden ausschließlich Einhebegebühr und die Gemeindeumlage geltend gemacht werden, den an die Kirche abzuführende Teil des Kirchenbeitrages nicht (gilt für Gemeinden A.B.).
Was sonst noch zu beachten ist:
Bei Antragstellung ist bei der Rechtsform die Auswahlmöglichkeit „nicht eingetragen im Firmenbuch“ anzuklicken.
Weitere Informationen zu NPO-Förderungen siehe: https://npo-fonds.at/
Alle aufklappen Alle zuklappen
Kirche als Arbeitgeber:
Beim Betreten des Arbeitsortes gibt es grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr.
Personen mit positiven Testergebnis auf SARS-CoV-2 dürfen den Arbeitsplatz betreten, wenn das Tragen eines MNS am Arbeitsort und am Weg zum Arbeitsort aus medizinischen Gründen, insbesondere Schwangerschaft, nicht unmöglich ist oder das Erbringen der Arbeitsleistung durch das Tragen einer Maske möglich ist und sonstige Schutzmaßnahmen getroffen werden können.
In begründeten Fällen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von COVID-19 können strengere Regelungen durch den Dienstgeber bzw. die Dienstgeberin vorgesehen werden.
Alle Dienstgeber bzw. Dienstgeberinnen sind zudem aufgrund der Fürsorgepflicht arbeitsrechtlich verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeitenden zu treffen. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, können sie haften.
Diese Frage kann derzeit nicht einheitlich beantwortet werden, da zusätzlich zur Verordnung des Gesundheitsministers in einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgestaltete, strengere Bestimmungen gelten können. Informieren Sie sich daher über die in Ihrem Bundesland konkret geltenden Bestimmungen für „Kranken- und Kuranstalten und Alten- und Pflegeheime“. Eine Übersicht über die regionalen Maßnahmen finden Sie auf corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/ oder auf der Homepage der Landesregierung. Die rechtsverbindlichen Verordnungen können über das RIS (www.ris.bka.gv.at/Land/) abgerufen werden.
Bitte beachten Sie weiters, dass der Betreiber bzw. die Betreiberin betreffender vulnerabler Einrichtungen aufgrund des Hausrechts noch strengere als die in den Bundesländern speziell geltenden Regelungen festsetzen können. Informieren Sie sich daher bei jedem Besuch beim Betreiber bzw. der Betreiberin der jeweiligen Einrichtungen, welche Coronaregelungen in dieser Einrichtung gelten.
Die bundesweit geltenden Mindestvorgaben aufgrund der Verordnung des Gesundheitsministers (Stand: 15.12.2022) lauten wie folgt:
Alten- und Pflegeheime:
- Beim Betreten von Alten- und Pflegeheimen müssen Besucher und Besucherinnen, Begleitpersonen, Mitarbeitende, externe Dienstleister und Bewohner und Bewohnerinnen (an den nicht zum eigenen Wohnbereich gehörigen Orten) eine FFP2-Maske in geschlossenen Räumen tragen, sofern das Infektionsrisiko nicht durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert werden kann.
Kranken- und Kuranstalten und sonstige Orte mit Gesundheits- und Pflegedienstleistungen:
- Beim Betreten von Kranken- und Kuranstalten und sonstiger Orte mit Gesundheits- und Pflegedienstleistungen müssen Patienten und Patientinnen, Besucher und Besucherinnen, Begleitpersonen, Mitarbeitende, externe Dienstleister und der Betreiber, bzw. die Betreiberin eine FFP2-Maske in geschlossenen Räumen tragen, sofern das Infektionsrisiko nicht durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert werden kann.
Auch für Mitarbeitende von Gemeinden oder Werken gilt der Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit nach staatlichem Recht.
Im Moment findet die Sonderbetreuungsphase 7 statt, welche am 05. September 2022 gestartet ist und bis 31. Dezember 2022 dauert. Antragsstellung ist bis 11. Februar 2023 möglich.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Kinder bis zum 14. Lebensjahr oder Menschen mit Behinderungen betreuen müssen oder Angehörige pflegebedürftiger Personen sind, sollte mit Hilfe der Sonderbetreuungszeit im Ausmaß von bis zu drei Wochen möglich gemacht werden, der Betreuung bei laufendem Arbeitsverhältnis nachzugehen.
Der Rechtsanspruch für die Sonderbetreuungszeit kommt für all jene in Betracht, die
- eine Pflicht zur Betreuung zumindest eines Kindes unter 14 Jahren oder eines Menschen mit Behinderung trifft, wenn die Betreuung normalerweise in einer Einrichtung oder Lehranstalt bzw. Kinderbetreuungseinrichtung erfolgt und diese aufgrund behördlicher Maßnahmen ganz oder teilweise (z.B. Klassen oder Gruppen) geschlossen ist;
- eine Pflicht zur notwendigen Betreuung für ein unter 14-jähriges Kind haben, welches behördlich unter Quarantäne gestellt wurde
- Angehörige eines Menschen mit Behinderung mit persönlicher Assistenz sind und diese in Folge von COVID-19 nicht mehr sichergestellt ist, oder
- Angehörige eines pflegebedürftigen Menschen sind, dessen Betreuungskraft ausfällt.
Voraussetzung für den Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit ist, dass die Betreuung des unter 14-jährigen Kindes, des Angehörigen mit Behinderung oder des Pflegebedürftigen notwendig ist. Eine Betreuung ist dann notwendig, wenn keine andere geeignete Person die Betreuung übernehmen kann. Die Notwendigkeit der Betreuung eines Kindes unter 14 Jahren ist z.B. dann gegeben, wenn auch der andere Elternteil aufgrund seiner Berufstätigkeit nicht zur Betreuung zur Verfügung steht und auch andere Verwandte (wie etwa Tante, Onkel oder ältere Geschwister) oder Bekannte, die bereits auf das Kind aufgepasst haben und in einem „sozialen“ Naheverhältnis zum Kind stehen, das Kind nicht in der fraglichen Zeit betreuen können. Eine Betreuung durch Großeltern oder sonstige Angehörige einer Risikogruppe wird nicht zugemutet.
Findet daher zwar während eines Lockdowns in der Schule kein Präsenzunterricht statt, wird aber eine Betreuung angeboten, besteht kein Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit. In diesem Fall kann aber mit dem Arbeitgeber eine Sonderbetreuungszeit vereinbart werden.
Voraussetzung für den Anspruch ist ferner, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer den Arbeitgeber unverzüglich nach Bekanntwerden der Schließung, Absonderung oder Ausfall der persönlichen Assistenz bzw. der Betreuungskraft verständigt und alles Zumutbare unternimmt, damit die vereinbarte Arbeitsleistung zustande kommt.
Ein Ausschöpfen von bestehenden anderen arbeitsrechtlichen Ansprüchen auf Dienstfreistellung ist für den Anspruch auf Sonderbetreuungszeit nicht erforderlich, insbesondere muss der Anspruch auf Pflegefreistellung nicht zuvor aufgebraucht werden.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Kinder bis zum 14. Lebensjahr oder Menschen mit Behinderungen betreuen müssen oder Angehörige pflegebedürftiger Personen sind, sollte mit Hilfe der Sonderbetreuungszeit im Ausmaß von bis zu drei Wochen möglich gemacht werden, der Betreuung bei laufendem Arbeitsverhältnis nachzugehen.
Eine Sonderbetreuungszeit ist von bis zu drei Wochen vorgesehen. Je nach individueller Situation könnte es auch ein kürzerer Zeitraum wie z.B. nur 2 Wochen sein, wenn der volle Zeitraum nicht ausgeschöpft wird.
Die Sonderbetreuungszeit muss nicht in einem Stück, sondern kann auch wochenweise, tage- oder halbtageweise (nicht jedoch stundenweise) verbraucht werden. Insgesamt kann während des Zeitraumes von 5. September 2022 bis 31. Dezember 2022 für die Sonderbetreuungsphase 7, auch wenn sie in Teilen genommen wird, höchstens einen Zeitraum von insgesamt 3 Wochen (21 Kalendertagen) umfassen.
Die Anträge für die Sonderbetreuungszeit Phase 7 können bis 6 Wochen nach dem vollständigen Konsum der Sonderbetreuungszeit bis spätestens 11. Februar 2023 bei der Buchhaltungsagentur des Bundes eingebracht werden.
Im Unterschied zur Sonderbetreuungszeit der Phase 6 gibt es in der Phase 7 keine Möglichkeit der Vereinbarung der Sonderbetreuungszeit.
Ja.
Arbeitgeber können 100 Prozent des gezahlten Entgelts bis zur monatlichen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage (2022: EUR 5.670,00) für die Sonderbetreuungsphase 7 zurückerstattet bekommen. Die maximale Dauer der Sonderbetreuungszeit liegt bei drei Wochen (21 Kalendertagen) und somit wird daher maximal für 2022 EUR 3.969,00 ausgezahlt. Die Abwicklung läuft über die Buchhaltungsagentur des Bundes: www.buchhaltungsagentur.gv.at/sonderbetreuungszeit/
Auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend:
www.bmaw.gv.at/Infos-FAQ/corona-massnahmen/massnahmen-arbeit/FAQ–Sonderbetreuungszeit.html
Oder auf der Seite der Buchhaltungsagentur des Bundes in Bezug auf die finanzielle Entschädigung:
www.buchhaltungsagentur.gv.at/sonderbetreuungszeit/
Der Dienstgeber ist zudem aus der Fürsorgepflicht heraus verpflichtet Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Zu derartigen Maßnahmen zählt auch Treffen mehrerer Personen tunlichst zu vermeiden und Veranstaltungen z.B. online abzuhalten.
Die Teilnahme an einer dringend notwendigen Sitzung zwecks Vornahme einer unaufschiebbaren Nachwahl kann daher eine Dienstpflicht sein. Die Teilnahme an einer formlosen Teambesprechung die genauso gut auch online stattfinden könnte aber nicht (Stand 3.5.21).
Die Berufsgruppen sind vom Gesetzgeber definiert, es handelt sich dabei um: „Beschäftigte in Krankenhäusern, Heil- und Pflegeanstalten, Entbindungsheimen und sonstigen Anstalten, die Personen zur Kur und Pflege aufnehmen, öffentliche Apotheken, ferner Einrichtungen und Beschäftigungen in der öffentlichen und privaten Fürsorge, in Schulen, Kindergärten und Säuglingskrippen und im Gesundheitsdienst sowie in Laboratorien für wissenschaftliche und medizinische Untersuchungen und Versuche sowie in Justizanstalten und Hafträumen der Verwaltungsbehörden bzw. in Unternehmen, in denen eine vergleichbare Gefährdung besteht.“
Der begründete Verdacht auf das Vorliegen einer beruflich erworbenen COVID-19-Infektion ist dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden. In den meisten Fällen ist dies in Österreich die AUVA. Die Meldung muss durch behandelnde Ärztinnen bzw. Ärzte, Arbeitsmedizinerinnen bzw. -mediziner und/oder Dienstgeberinnen bzw. Dienstgeber erfolgen. Die Versicherten können auch selbst melden.
Weitere Auskünfte erteilt die AUVA:
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.867378&portal=auvaportal
Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit.
Alle aufklappen Alle zuklappen
ISSN 2222-2464

